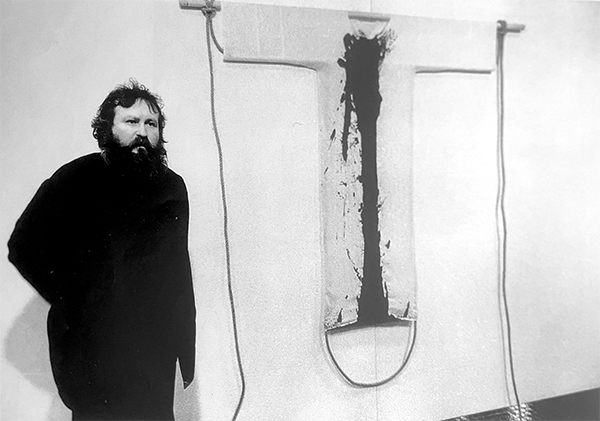Der Gymnasiast sah eine „Kunstaktion“ in einem Wiener
Theaterkeller. Nachher erklärte man ihm, das sei Kunst gewesen,
und zwar „ein Durchgang, kein Objekt“. Das Werk als Objekt war
abgeschafft. Er war erst achtzehn Jahre alt und konnte den
Unterschied sprachlich noch nicht fassen. Doch sein Erleben war
unverstellt. Er erlebte Hermann Nitsch, wie er ein Tier zerriss, das er
sich vom Fleischhauer geholt hatte. Mit dem Blut, das damals ein
echtes Blut war, beschmierte er sich den Hals und betatschte er
halbnackte, junge Leute. Teile des Tieres zerrte er auseinander und
stieß dabei unverständliche Schreie aus. Blutgeruch lag in der kalten
Luft. Ein abendlich gekleidetes Pärchen sagte „Oh!“ und “Ah!“.
Zwischen seinen Handgriffe legte Nitsch manchmal eine Pause
ein, wie sie ein Priester in der Messe macht. Alles schien
bedeutsam zu sein. Nur: Was bedeutete es? Jahre nach seinem
Studium las er, dass die Aktionen von Nitsch - angeblich - den
Moment bezeichnen, wo die Kunst schon etwas Eigenes ist,
sich aber von Religion noch nicht abgetrennt hat.
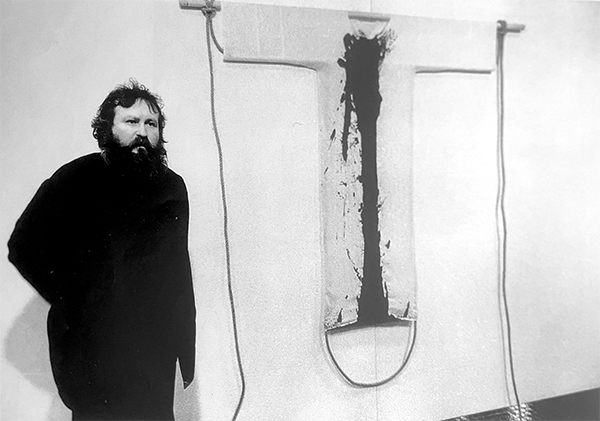
Hermann Nitsch, Werk, 1983 ausgestellt.
Kurz vor der Matura brach der Gymnasiast die Schule ab. Er
war ein Schulschwänzer, der im letzten Schuljahr genau so viele
Schulstunden auf dem Konto hatte wie Fehlstunden. Die Fehlstunden
waren nicht entschuldigt. Dieser Schüler war ein Fall von
Verwahrlosung. Seine Eltern hatten Besseres zu tun, als sich
um ihn zu kümmern. Die Lehrer waren verärgert über die
ständige Abwesenheit des Schülers und gaben ihm auch
dort, wo er eine gute Prüfung abgelegt hatte, nur einen Vierer.
Die anderen Lehrer waren gerecht und gaben Fünfer. Am
Ende wurde die Schule ganz gemieden. Der Junge schlief lange,
frühstückte lange und war schon am Vormittag im Kino.
Gegenüber der Schule war ein Kaffeehaus, das jugendliche Raucher
und Trinker frequentierten. Der Schuldirektor tauchte manchmal
dort auf, packte einen Schüler und führte ihn im Polizeigriff in
die Schule zurück. Einmal wurde der Mann gefragt, warum er
einen Buben am Ohr über die Straße führte. Seine Antwort war:
Ich kann ihn nur rausschmeißen – oder ihm eine runterhauen! - Er
fragte den Buben: Was ist dir lieber? - Runterhauen!, sagte der
Junge, und dieser Hofrat brüllte auf: Das ist mir aber untersagt! -
Am Ohr! Am Ohr! Am Ohr!, sang wochenlang die halbe Schule.
Der besagte Gymnasiast malte sich die Abwehr des Direktors aus.
Der Mann war klein, er konnte leicht in dessen Brusthöhle
hineinstoßen, aber er musste in die Hocke gehen, um mit
dem Schlagring dessen Kniescheibe zu treffen. Von solchen
Dingen träumte der Gymnasiast.
Er brach - wie gesagt - die Schule ab. Um auf andere Gedanken zu
kommen, ging er neun Monate lang zum Bundesheer. Nach dem
Bundesheer verfolgte er die Idee der wertlosen Matura weiter.
Er versuchte nicht, auf einem Seitenweg in die Gesellschaft hinein
zu kommen, sondern besuchte eine Maturaschule. Dort traf er
auf andere Spätzünder und Verlorene. Der gescheite Tomek. Die
sanfte Christine. Der stille Alex. In der Galerie, in der Christine
arbeitete, versuchte der Externist die Moderne Kunst zu verstehen.
Er studierte ein Ding aus Holz und aus Sperrmüll von vorne und von
hinten ganz genau. Was er sah, fasste er in Worte. Seine Worte ergaben
keinen Sinn. Das Ding steht nur da, sagte er, und ist frech! - Ja
warum?, fragte Christine und er wusste damals keine Antwort.
Heute weiß er, was das Ding in einem weißen Raum wirklich sagt:
Ich stünde nicht da, wäre ich keine Kunst! - Er besuchte einen
Abend von Otto Muehl. Die Angstlosigkeit des Muehl hätte ihm
gefallen müssen, doch sie war mit Schamlosigkeit gepaart und mit Tiraden,
die er nicht verstand. Muehl entkorkte Sektflaschen zwischen seinen
Beinen und spritzte Sekt ins Publikum. Er schrie er von Wichteln,
die er schlachten wollte, und es war unklar, was er damit meinte.
Die Hippies, die der junge Mann im In- und im Ausland kennen
lernte, waren ihm weitgehend sympathisch. Ihre Ablehnung
der Eltern und ihre Ablehnung der Gesellschaft waren okay,
doch ihr öffentliches Auftreten war ihm peinlich. Die Performance
der Hippies musste er tolerieren. 1968 – stürmten in Paris
Polizisten auf selbstbewusste Studenten los und interviewten in Prag
Reporter kecke Jugendliche auf Russenpanzern. Er glaubte, dass
die Jungen auf der ganzen Welt nur für sich selber kämpften,
und spürte gleichzeitig die weltweit mitmachenden Medien sehr
stark. Wenn er in der Zeitung von einem Sitzstreik las oder auf
der Straße Ho – Ho- Tschi – Minh – Schreie hörte, erblickte er darin
das Neue. Diesen Klang und diesen Hauch nahm er begierig auf.
Er dachte: Das Neue wird jetzt jeden Winkel der Gesellschaft
befreien, doch das tat es nicht. Es befreite nur den Kapitalismus.
Er wurde Mitglied in einem Verein, der in Wien den „Art Club“
weiter führen wollte, sich aber nur zwei Jahre lang hielt. In
diesem „Art Center“ (in der Hohenstaufengasse) präsentierte
der Vorstand den „Film ohne den Film“ auf einer unverputzten
Wand. Einer aus dem Vorstand stellte sich in den Lichtkegel
des Bildwerfers und bewegte sich möglichst nicht. Er stand
nahe der Wand und wurde vom Licht des Leerkaders überflutet.
Dazu gab es das Geräusch einer Kamera, das von einem
Tonbandgerät kam. Die Tasten des Tonbandgerätes drückte der
Externist. In diesem seltsamen Lokal, in dem die Hippies friedlich
zechten, saß er zwischen sanften Giftlern und gescheiten
Neinsagern ruhig da. Er durfte mitmachen und wurde toleriert, obwohl er durch seinen Anzug und durch seine Stoppelglatze
als Anderer zu erkennen war. Er durfte sogar den Wächter
in der Türe spielen, der die eintretenden Hippies zu mustern
hatte. Ein Jazzmusiker stellte sich manchmal zu ihm hin
und half ihm, die erwünschten von den unerwünschten Gästen
zu unterscheiden. Einmal ging ein Pressegirl in den verrauchten
Räumen umher und knipste den gaumig vorlesenden Hermann
Schürrer. Über den schlanken Günter Brus warfen der Maturaschüler
und der Musiker einen Plastikvorhang und schoben den
Strampelnden in die Küche zu den Köchinnen ab. Er hatte
vor der Journalistin onanieren wollen.

Günter Brus, Wiener Spaziergang, 1965.
Die Externisten – Matura wurde in Baden bei Wien abgelegt. Dort
war ein strenger Schulinspektor der Schutzengel des jungen
Mannes. Er zwang den Fachlehrer, ihn in Englisch durchzulassen.
Bei der Verabschiedung der Prüflinge rief er durch den Saal
„Wo ist der Engländer?“ und schüttelte dem jungen Mann
die Hand, während der Englischlehrer sauer daneben stand.
Jener scharfe Typ mit Glatze und weißem Stecktaschentuch
wurde schließlich zum einzigen Lehrer, der bei dem künftigen
Studenten einen günstigen Eindruck hinterließ. Nach der Prüfung
eilten die jungen Leute zwischen Kastanienbäumen und gelben
Häusern von der keimtötenden Schule weg. Sie entkorkten
schon in der Schnellbahn eine Flasche Sekt und stießen auf
ihren Erfolg an.
Bei den Fächern, die der junge Mann jetzt studierte, setzte
er die „Lehre von der Gesellschaft“ an die Stelle der
„Geschichte der Kunst“, die ihn ursprünglich interessiert hatte.
Eine der ersten Vorlesungen, die er hörte, war über die Geschichte
der amerikanischen Gewerkschaften. Das war ein Wissen, nach
dem nicht jeder Österreicher verlangt. Er hörte vom Idealismus
der IWW und vom Mobstertum der großen Gewerkschaften.
Kriminelle und nicht-kriminelle Arbeiterführer in Amerika beriefen
sich manchmal auf amerikanische Soziologen, die ihre Wissenschaft
deutschen Soziologen verdankten.
Der Kontakt zu den Freunden aus der Maturaschule war noch
vorhanden. Der gescheite Tomek studierte „Geschichte“ und
war der Meinung, dass der Geschichtsunterricht in Österreichs
Schulen bei der Rettung der Bodenkreditanstalt 1931 endete.
Dem trat der Soziologiestudent nicht nahe, weil er selber in
Geschichte über die UNO abgeprüft worden war. Der stille
Alex musste sich sein Studium an der Technischen Universität
selbst bezahlen. Er verdiente es sich, indem er Taxi fuhr und
Schreibmaschinen reinigte. Er zerlegte und wusch die „Kleine Erika“
des Soziologiestudenten, während ihm dieser vom Ende
des Jimmy Hoffa erzählte. Wenig später kam jener Freund
durch einen Unfall ums Leben. Bei einer Kreuzung in Schwechat,
die auf gelb geschaltet war, rammte ein Tankwagen von
links die Fahrertür des Taxis, das Alex lenkte. Auf der
gereinigten Schreibmaschine tippte der Soziologiestudent
achtzehn Todesanzeigen auf schwarz geränderte Karten. Dann fuhr
er nach Salzburg, zu Alex´ Mutter, zu einem traurigen Begräbnis.
Die Universitäten in Westeuropa waren einst eine Schutzzone
für junge Leute. Diese strebten nicht primär nach akademischer
Würde, sondern wollten eine Zeit der Besinnung durchlaufen,
ohne die Effizienz – Regeln der Gesellschaft. Der
Soziologiestudent fühlte sich wohl - und gab trotzdem die
Soziologie eines Tages auf. Der Grund für seine Entscheidung
war, dass er Begriffe nicht nur definieren, auch anwenden wollte.
Eine Welt aus Begriffen bauen! Es drängte ihn zur Darstellung
und zur Darstellung auf der Bühne – deshalb „Lehre vom
Theater“. Im Hörsaal 50, fast unter dem Dach, hörte er eine
Professorin, die ihm sehr gefiel, über das Barocktheater
vortragen. Sie gefiel ihm nicht körperlich, sie sah schrecklich
aus, aber geistig, weil sie klug und gezirkelt sprach. Sie war
die Selbstbeherrschung in Person und zugleich freundlich und
zugewandt.
Margret Dietrich hörte sich, auch wenn die Vorlesung schon
aus war, jede Frage mit Engelsgeduld an. Oft trat ein Assistent
zu ihr hin und flüsterte ihr den nächsten Termin ins Ohr. Dann
zeigte sie auf eine große Uhr und öffnete bedauernd ihre massigen
Arme. Sie wollte sich die gestellte Frage merken und am
Beginn der nächsten Stunde beantworten. In der nächsten
Stunde suchte sie den Fragenden vom letzten Mal, er sollte
seine „sehr sehr interessante Frage“ wiederholen. Dieser
oder diese war in der Regel nicht mehr präsent und die Dietrich
rief: „Sind also die Fragesteller nicht mehr unter uns?! Ich gehe
damit im Stoff weiter!“
Diese Professorin wollte eine Antwort auf die Frage finden, ob die
Arbeiter in der Fernsehepoche ein „Arbeitertheater“ wirklich
wünschten. Das Ziel ihrer Feldforschung war ein Nein. Theater
beginnen spät. Arbeiter gehen früh schlafen. In der Wohnküche
sitzt der Arbeiter mit seinem Gast. Im Theater strebt er zum Buffet.
Die Forschung führten zehn Studierende mit jeweils einem
Arbeiter oder einer Arbeiterin durch. Der Student der Theaterwissenschaft nahm mit einer Tante daran teil. Er schleppte die
Frau ins Akademietheater, wo Margret Dietrich im Foyer
stand und jeder Versuchsperson die Hand schüttelte.
Die Tante des Studenten war eine hübsche Frau, die nie einen Beruf ausgeübt hatte und nun als Eine aus dem
Arbeitsvolk fungierte. Sie sah sich das Stück „Alle meine
Söhne“ an und beantwortete dann zwölf von zwanzig Fragen
sehr originell. Ihr Satz „Arbeiter essen mehr als Angestellte
und Akademiker, weil sie mehr Kalorien verbrauchen“ ging als
Kapitel – Überschrift in jene Studie ein.
Um 1975 besuchte der Student im Museum für Moderne Kunst
eine Ausstellung der Concept Art in Wien. Diese Amerikaner,
dachte er, trennen sich nie ganz von ihrer Tradition. Sie
reiten nie auf schwarzen Quadraten - und nie auf übermalten
Zeichnungen - herum, sondern machen Werke, in denen
sich das Alte und das Neue findet. Da hatte er sich geirrt. Die
gezeigten Amerikaner schoben die Ausführung ihrer Objekte
dem Betrachter hin. Der Student der Theaterwissenschaft
fand bunte Raster gemalt oder aufgeklebt auf weißen Wänden
und Fotos und Tagebücher und Skizzen (und blecherne Kuben
und Zylinder, die an Drähten hingen). Er stieg dort auf und ab –
nahm auf einem Klappstuhl Platz – legte sich auf einer
Luftmatratze flach - und hatte Null Einfälle zu dieser Kunst.
Er fühlte sich unglücklich und gereizt. Die anderen Besucher
schienen friedlich. Ihre Gesichter und Körper passten nicht
zu den leeren und aggressiven Objekten.
Am Ende seines Studiums hielt Professorin Dietrich ihm und
anderen neu geschaffenen Doktoren und Doktorinnen eine
Rede: „Durch Ihre schönen Arbeiten und Ihre guten Prüfungen
haben Sie das Tor zu einer größeren Welt aufgestoßen. Sie werden
jetzt in die größere Welt hinein gehen. Jeder auf eine andere Art.
Ich wünsche Ihnen, dass Sie nie anecken. Ganz besonders
wünsche ich das Herrn Quell (damit meinte sie den besagten
jungen Mann), dass ihm alles Unbedachte und Ungestüme, zu
dem er neigt, verziehen und nicht schuldhaft angerechnet wird.
Und jene von Ihnen, die nach München gehen, grüßen mir
bitte im Kärntnertor – Theater den Dr. Seyfert! Er gehörte einst
auch zu meinen Besten!“
Am Hauptbahnhof in München kam der neue Doktor um Null Uhr
an. Er ging vor dem Bahnhof auf und ab, weil sich sein Münchner
Freund verspätet hatte. Zwei Bayern in Trachtenhosen stiegen
aus einem Bus und brüllten: „Es lebe Videla! Nieder mit den
Terroristen!“ - Damit erlebte Dr. Quell einen Moment der Zeitgeschichte
aus Dritter Hand. Er wusste nur nicht, was mit dem Wort
„Terroristen“ gemeint war. Erst am nächsten Tag, nachdem er
in der Wohnung seines Freundes abgestiegen war, sah er im
Wartezimmer eines Zahnarztes die Fahndungsbilder
deutscher Terroristen an der Wand. Da begriff er die Schreie
der Trachtenheinis im Nachhinein.
In München arbeitete er für den Rundfunk. In seiner Freizeit
spielte er Publikum für Amateure. Er hörte Lesungen in
Galerien und Arien in Stadtsälen. Er verfolgte Kabarett –
Nummern in Gasthäusern. Höhepunkt war sein Besuch eines
„Wiener Abends“ in einem Kleintheater. Regisseur und
Hauptdarsteller war der Freund, der ihm die Wohnung zur
Verfügung gestellt hatte. Er trug Strapse über einer Badehose
und wollte sich im Stück mit einem Zweiten paaren. Dieser
hatte die Rolle eines Fiaker-Pferdes übernommen. Ein Dritter
spielte den „Gott aus der Maschine“ und kritisierte mit der Stimme
von Bruno Kreisky die Gegner des Kraftwerkes von Zwentendorf
(„Für mich sind das Rotzbuben und von Rotzbuben lasse ich
mich nicht vorführen!“). Nach der Darbietung verlangte der
Freund von Dr. Quell, dass dieser eine Rezension des Abends
fürs Radio machen sollte. Der Doktor sagte Nein und enttäuschte
dadurch ein paar Freunde.
In der Wohnung in München beschlief Dr. Quell eine
Jungschauspielerin aus Köln. Das war eine lustvolle und
schräge Vereinigung, bei der die Kopulierenden durch die
Straßenbeleuchtung in der Straßenmitte beleuchtet wurden.
Nach dem geglückten Geschehen fand der Doktor das Blut
der jungen Frau auf seinem Bauch, im Bett und auf dem Teppich
überall verteilt. Er erschrak ein bisschen über dieses Blutbad,
wohingegen das Girl, eine Moderne der 1970 er Jahre, völlig
cool blieb. „Was soll‘s!, sagte sie, „Stell dir vor, du und ich, wir
haben heute Nacht jemanden geschlachtet!“ - Dadurch
schien die Kunstmoderne irgendwie entschuldigt. Das vom
Inhalt abgetrennte Reden galt nicht nur in der Kunst, auch
im täglichen Leben als ein Akt der Befreiung.
© M.Luksan, August 2023
|